Beispiele für Beratung
Hier finden Sie 3 verschiedene Beispiele zur Beratung.
In einer Stadt gibt es einen Klein·garten·verein.
Dort sind viele kleine Gärten nebeneinander.
Die Gärten gehören zu verschiedenen Personen.
Die Personen sind Mitglieder im Klein·garten·verein.
Der Verein hat einen Vorsitzenden.
Das ist der Chef vom Verein.
In den Gärten kann man Blumen pflanzen.
Man kann auch Gemüse anbauen.
Und man kann sich erholen.
Das Problem
Einige Mitglieder beschweren sich beim Vorsitzenden über Lärm.
Der Lärm kommt aus einem Garten.
In dem Garten treffen sich abends Rechts·extreme.
Die Rechts·extremen machen laut Musik.
Es ist Rechts·rock·musik.
Das ist Rock·musik mit rechts·extremistischen Texten.

Über dem Garten weht eine Reichs·flagge.
Eine Reichs·flagge ist eine schwarz-weiß-rote Fahne.
Früher haben National·sozialisten diese Flagge benutzt.
Die National·sozialisten waren eine Partei.
Der Chef von der Partei war Adolf Hitler.
Die National·sozialisten haben viele Millionen Menschen ermordet.
Zum Beispiel:
- Juden und Jüdinnen.
- Menschen mit Behinderung.
- kranke Menschen.
Rechts·rock·musik ist ein Zeichen von Rechts·extremismus.
Die Reichs·flagge ist auch ein Zeichen von Rechts·extremismus.
Rechts·extremismus ist gefährlich.
Denn Rechts·extreme benutzen manchmal auch Gewalt.
Deshalb will der Vorsitzende vom Verein etwas
gegen die Rechts·extremen tun.
Der Vorsitzende weiß aber nicht genau:
Was kann man da machen?

Die Beratung
Der Vorsitzende fragt die Mobile Beratung Niedersachsen.
Ein Mitarbeiter von der Mobilen Beratung fährt zum Vorsitzenden.
Alle überlegen gemeinsam:
- Was möchte der Vorsitzende?
- Wie kann man das erreichen?

Der Mitarbeiter macht 2 Vorschläge:
- Man kann die Satzung ändern.
In der Satzung stehen die Regeln vom Verein.
Zum Beispiel:
Wofür darf man die Gärten nutzen?
Alle Mitglieder müssen sich an die Regeln halten.
- Man kann die Haus·ordnung ändern.
In der Haus·ordnung stehen auch Regeln.
Zum Beispiel:
Wann darf man in den Gärten Lärm machen?
Der Mitarbeiter und der Vorsitzende schreiben
- eine Änderung für die Satzung.
- eine Änderung für die Haus·ordnung.
Der Vorsitzende informiert die Mitglieder vom Verein über die Änderungen.
Alle zusammen arbeiten an den neuen Regeln.


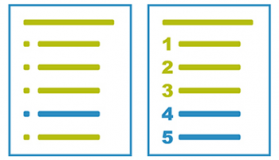
Das Ergebnis
Die neuen Regeln sind gut.
Der Vorsitzende kann jetzt was gegen die Rechts·extremen tun.
Zum Beispiel:
- Eine politische Versammlung in den Gärten ist jetzt verboten.
- Rechts·extreme Musik ist jetzt verboten.
- Rechts·extreme Zeichen sind verboten.
Beachten die Rechts·extremen nicht die neuen Regeln?
Dann kann der Vorsitzende den Miet·vertrag für den Garten kündigen.

In einer Stadt gibt es ein neues Bündnis.
Ein Bündnis bedeutet:
Bürger und Bürgerinnen tun sich zusammen.
Die Bürger und Bürgerinnen sind Mitglieder vom Bündnis.
Es ist ein Bündnis gegen Rechts·extremismus.
Die Bürger und Bürgerinnen wollen etwas gegen Rechts·extremismus tun.


Das Problem
Für die Mitglieder vom Bündnis ist die Arbeit im Bündnis neu.
Die Mitglieder haben damit noch keine Erfahrung.
Die Mitglieder möchten sich beraten lassen.
Die Mitglieder fragen die Mobile Beratung Niedersachsen.
Die Beratung
Eine Mitarbeiterin von der Mobilen Beratung fährt
zu den Mitgliedern vom Bündnis.

Die Mitarbeiterin schlägt vor:
- Die Mitglieder sollen zuerst überlegen:
- Wer sind wir?
- Was wollen wir?
- Warum wollen wir das?
- Die Mitglieder sollen dann überlegen:
- Was wollen wir als erstes gegen Rechts·extreme tun?
- Wer von uns macht was?
- Die Mitglieder sollen zuerst überlegen:
Die Mitglieder vom Bündnis finden die Vorschläge gut.
Das wollen die Mitglieder zuerst tun:
Die Mitglieder wollen andere Menschen
über Rechts·extremismus informieren.
Dazu wollen die Mitglieder Veranstaltungen machen.
Die Mitglieder wollen Experten und Expertinnen einladen.
Die Experten und Expertinnen sollen
- auf einer Bühne sitzen.
- über Rechts·extremismus sprechen.
- über Rechts·extremismus Vorträge halten.
So erfahren andere Menschen von Rechts·extremismus.

Solche Veranstaltungen kosten Geld.
Die Mitglieder vom Bündnis haben aber kein Geld.
Die Mitarbeiterin von der Mobilen Beratung schlägt vor:
Die Mitglieder können Geld beantragen.
Die Mitarbeiterin von der Mobilen Beratung
- gibt den Mitgliedern die Adressen von Geld·gebern.
- erklärt die Formulare für die Anträge.
Das Ergebnis
Die Mitglieder von dem Bündnis beantragen Geld.
Die Mitglieder bekommen das Geld.
Die Mitglieder machen Veranstaltungen.
So wird das Bündnis in der Gegend bekannt.
Die Mitglieder lernen viele Menschen kennen.
Einige von den Menschen machen auch was gegen Rechts·extremismus.
Die Mitglieder vom Bündnis wollen mit den Menschen zusammen arbeiten.
Gemeinsam ist man stark.
Gemeinsam kann man sich helfen.
Gemeinsam kann man was gegen Rechts·extreme tun.

In einer Stadt gibt es eine Schule.

Ein Direktor leitet die Schule.
Das macht der Direktor nicht allein.
Andere Personen helfen dabei.
Alle zusammen sind die Leitung von der Schule.
An der Schule gibt es auch eine Sozial·arbeiterin.
Die Sozial·arbeiterin hilft bei Problemen an der Schule.
Die Sozial·arbeiterin hilft
- den Kindern.
- den Lehrern und Lehrerinnen.
- den Eltern.
Die Kinder in der Schule haben verschiedene Religionen:
- Einige Kinder sind Christen und Christinnen.
- Einige Kinder sind Muslime und Musliminnen.
- Einige Kinder sind Juden und Jüdinnen.
- Einige Kinder haben keine Religion.
Das Problem
Die Sozial·arbeiterin sieht:
Jemand hat die Wände beschmiert.
Da steht zum Beispiel:
Juden, wir kriegen euch.

Die Sozial·arbeiterin hört:
Einige Kinder benutzen Jude als Schimpf·wort.
Die Kinder rufen: Du Jude.
Das bedeutet:
An dieser Schule gibt es Anti·semitismus.
Anti·semitismus ist ein Teil von Rechts·extremismus.
Anti·semitische Menschen glauben:
- Juden und Jüdinnen gehören nicht zu Deutschland
- Juden und Jüdinnen sind schlecht.

Das haben früher auch die National·sozialisten geglaubt.
Die National·sozialisten waren eine Partei.
Der Chef von der Partei war Adolf Hitler.
Die National·sozialisten haben viele Millionen Menschen ermordet.
Zum Beispiel: Juden und Jüdinnen.
Die Sozial·arbeiterin möchte was gegen Anti·semitismus an der Schule tun.
Aber die Sozial·arbeiterin möchte nicht zum Direktor gehen.
Die Sozial·arbeiterin denkt nämlich:
Vielleicht hört der Direktor bei dem Thema nicht richtig zu.
Oder der Direktor findet das Thema nicht so wichtig.
Deshalb fragt die Sozial·arbeiterin die Mobile Beratung Niedersachsen.
Die Sozial·arbeiterin sagt ihren Namen erstmal nicht.
Die Beratung
Ein Mitarbeiter von der Mobilen Beratung spricht mit der Sozial·arbeiterin:
- Was genau ist das Problem?
- Wie ist es zu dem Problem gekommen?
- Wer ist von dem Problem betroffen?
- Welche Lösungen gibt es?

Der Mitarbeiter kennt sich mit solchen Problemen gut aus.
Der Mitarbeiter von der Mobilen Beratung schlägt vor:
- Der Mitarbeiter und die Sozial·arbeiterin sollen mit dem Direktor reden.
- Der Mitarbeiter und die Sozial·arbeiterin sollen auch
mit den anderen Personen von der Schul·leitung reden.
Die Gespräche sollen zeigen:
- Die Schul·leitung muss etwas gegen Anti·semitismus in der Schule tun.
- Die Schul·leitung muss schnell etwas tun.
Nach den Gesprächen gibt es viele Ideen:
- Die Schule soll Fort·bildungen für die Lehrer und Lehrerinnen machen.
Zum Beispiel eine Fort·bildung über dieThemen:
- Die Schule soll Fort·bildungen für die Lehrer und Lehrerinnen machen.
- Warum gibt es Anti·semitismus in der Schule?
- Wie zeigt sich Anti·semitismus in der Schule?
- Was kann man dagegen tun?
- Die Schule soll die jüdischen Kinder schützen.
Die Schule soll die jüdischen Kinder stark machen.
Zum Beispiel mit Rollen·spielen.
In Rollen·spielen können die Kinder üben.
Die Kinder üben zum Beispiel Antworten auf Beleidigungen.
Dazu soll die Schule Experten und Expertinnen einladen.

Das Ergebnis
Die Ideen sind gut.
Die Lehrer und Lehrerinnen lernen:
Es darf keinen Anti·semitismus an der Schule geben.
Anti·semitismus ist eine Gefahr für Juden und Jüdinnen.
An der Schule sollen sich alle sicher fühlen.

Die Lehrer und Lehrerinnen bekommen viele Tipps.
Zum Beispiel:
- Die Lehrer und Lehrerinnen müssen das Thema ernst nehmen.
- Die Lehrer und Lehrerinnen müssen im Unterricht
über Anti·semitismus sprechen.
- Die Lehrer und Lehrerinnen müssen besser aufpassen.
Zum Beispiel
- Die Lehrer und Lehrerinnen müssen auf beschmierte Wände achten.
- Und die Lehrer und Lehrerinnen müssen auf Schimpf·worte achten.
- Die Lehrer und Lehrerinnen müssen die jüdischen Kinder schützen.

Alle zusammen überlegen einen Plan:
Was wollen wir in Zukunft noch gegen Anti·semitismus tun?
